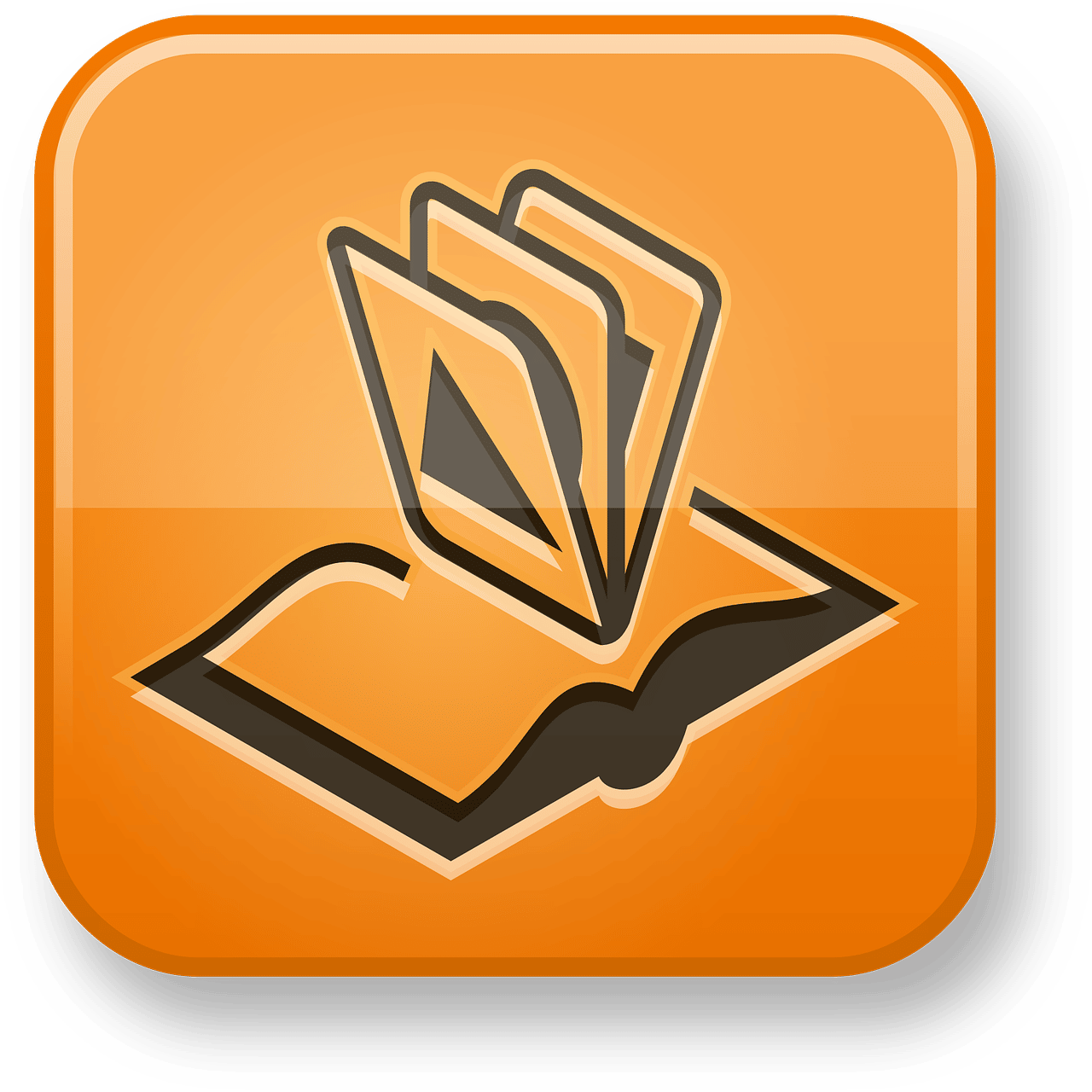Gründungen
Die ersten Glashütten im südlichen Schwarzwald wurden im 13. Jahrhundert gegründet. Die urkundlich nachweisbar ersten Glashütten waren die Gründungen der Glashütten und Hütten bei Altenschwand. Vom 14. bis 16. Jahrhundert folgten weitere Gründungen im gesamten Schwarzwald.
Wo nicht geflößt werden konnte waren die Glashütten die einzigen Abnehmer von Holz, da dieses in großen Mengen benötigt wurde. Insgesamt sind im südlichen Schwarzwald mindestens 90 Glashütten bzw. Glashüttenstandorte nachgewiesen (im gesamten Schwarzwald mindestens 192).
Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Hüttenstandortes waren neben Wasser v.a. reichliche Holz- und auch Sandvorkommen.
Glasherstellung
Zur Glasherstellung wurden benötigt:
- 60 Gewichtsanteile (GT) Kieselsäure (Sand/Quarz)
- 30 GT Pottasche
- 10 GT Kalk oder Kalkstein
Das Holz wurde nicht nur zur Befeuerung des Ofens benötigt, sondern in erster Linie zur Herstellung von Pottasche, die erforderlich war, um die Schmelztemperatur des Sandes von ca. 1.700 °C auf etwa 900 °C bis 1.100°C herabzusetzen. Den Kalk benötigte man als Stabilisator.
Das Waldglas war durch Verunreinigungen des Rohstoffs Sand mit unterschiedlichsten Metalloxiden in der Regel grün, bräunlich oder leicht grau gefärbt. Als man in Venedig herausgefunden hatte, dass man die ungewollte Grünfärbung mit Manganverbindungen (Braunstein), der „Glasmacherseife“, verhindern konnte, begann der Siegeszug des „gewaschenen“ Glases – auch im Schwarzwald. Schon 1516 unterscheidet man das „luter glas“ (lauteres, geläutertes, reines, farbloses Glas) im Gegensatz zum „geferbt glas“, was sich dann auch in der Unterscheidung zwischen dem „edleren Tafelglas“ zum „einfacheren“ Waldglas niederschlägt. Braunstein ist die Sammelbezeichnung für Mangan-Minerale und synthetisch hergestellte Manganoxide mit einer ungefähren Zusammensetzung von MnO1,7 bis MnO2. Der Name Braunstein stammt aus dem Mittelalter, er ist auf die braune Farbe zurückzuführen, die man beim Glasieren von Tonwaren mit Manganoxiden erhält. Braunstein wurde im Schwarzwald beispielsweise bei Gremmelsbach oder in der Grube Rappenloch bei Eisenbach im Hochschwarzwald, ca. 6 km NE von Titisee-Neustadt gefördert.
Herkunft der Rohstoffe:
Bei der Glasherstellung wurden weitgehend einheimische Rohstoffe verwendet. Als Quarz-Rohstoff dienten Milchquarz aus dem Kristallin des Schwarzwaldes oder meist tertiäre Quarzsande aus den Randgebieten des Schwarzwaldes. Alpine Gerölle aus den Moränen und Rheinschottern sowie Feuerstein kamen seltener zum Einsatz.
Der Kalkstein konnte ebenfalls aus den Randgebieten des Schwarzwaldes (Vorbergzone, Neckargebiet, Schwäbische Alb) beschafft werden.
Holzverbrauch:
Für die Herstellung von 100 kg Glas wurden anfänglich 200 m³ (!) Holz benötigt, später waren es noch knapp über 100 m³. Bei einem Jahresholzverbrauch von 5.000 bis 7.000 Ster pro Glashüttenstandort war der zugeteilte Wald oft in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren gerodet und die Hütte musste dem Wald nachziehen.
Hüttenplatz
An einem Hüttenplatz befanden sich mehrere Öfen: Zur Vorbereitung, zum Vorheizen (Fritten) und zum Kühlen.
An einem Ofen arbeiteten meist 8 bis 10 Glasbläser, mit je zwei bis drei Gehilfen. Der Glasofen wurde gemeinsam befeuert, aber jeder Glasmacher hatte seinen eigenen Glashafen, aus dem er das Glas für seine Produkte entnahm. Dazu kamen Schürer, die für das Feuer der Schmelze zu sorgen hatten, Pottaschemacher, Träger in der Hütte, Holzfäller und Fuhrleute.
Niedergang
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bestanden nur noch wenige Glashütten im Schwarzwald. Die letzten Hütten im Nordschwarzwald schlossen in den 1870er und 1880er Jahren, Äule schloss 1878, lediglich die Hütte Wolterdingen rettete sich noch knapp in das nächste Jahrhundert, um 1905 dann aber auch zu schließen.
Gründe für das Ende der vorindustriellen Glashütten im Schwarzwald waren v.a.
- Holzmangel
- steigende Holzpreise durch konkurrierende Industrien, v.a. Eisenwerke
- neue Ofentechniken (Befeuerung mit Steinkohle)
- Ersatz der Pottasche durch industriell hergestelltes Soda (Wegfall Standortfaktor Wald)
- ungünstige Lage
- Konkurrenz durch hochwertige Waren aus Böhmen, Schlesien etc.
Spurensuche
Welche Spuren der einstigen Glasproduktion im Südschwarzwald sind heute noch zu erkennen? Zahlreiche Familien- und Orts-/Gewannnamen weisen noch heute auf die frühere Glasherstellung im Schwarzwald hin.
Der Glasträgerweg soll helfen solche Spuren zu entdecken, v.a. soll er aber die Erinnerung an dieses alte Handwerk erhalten.